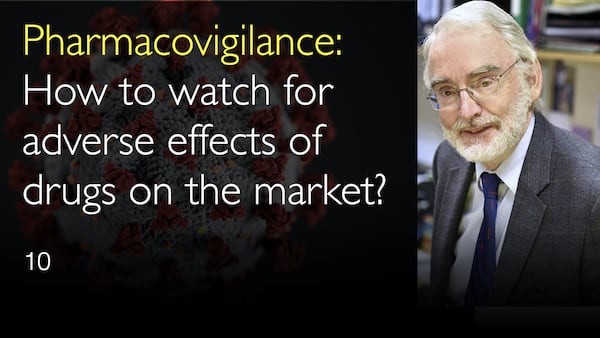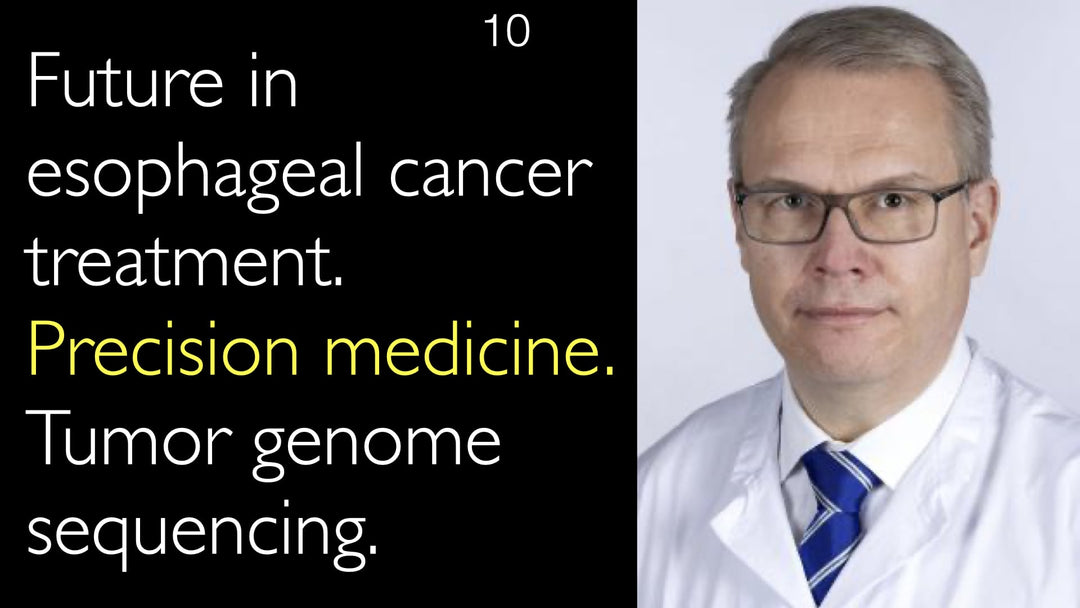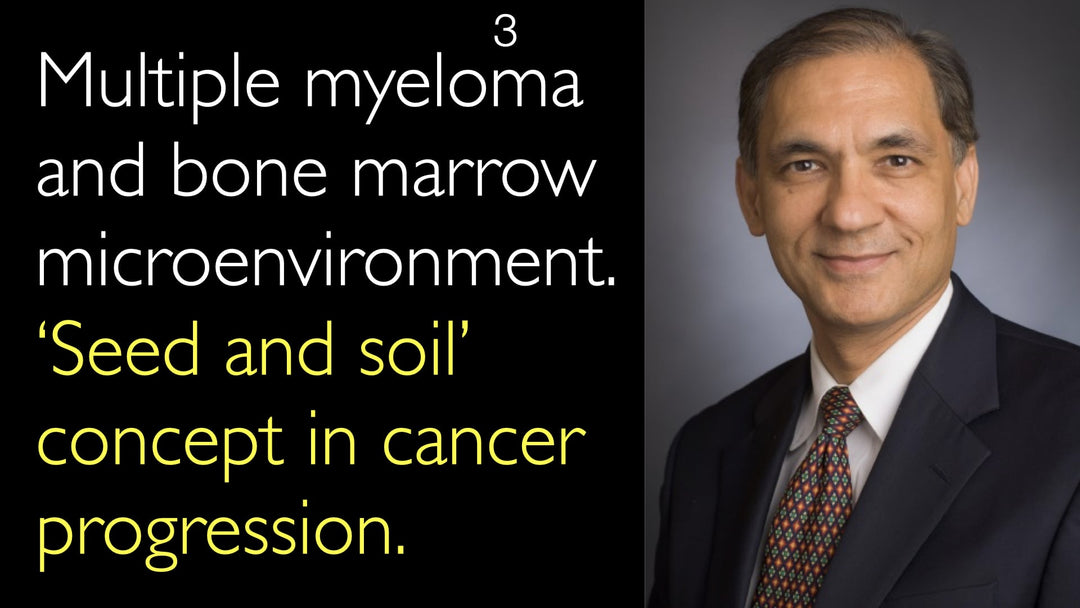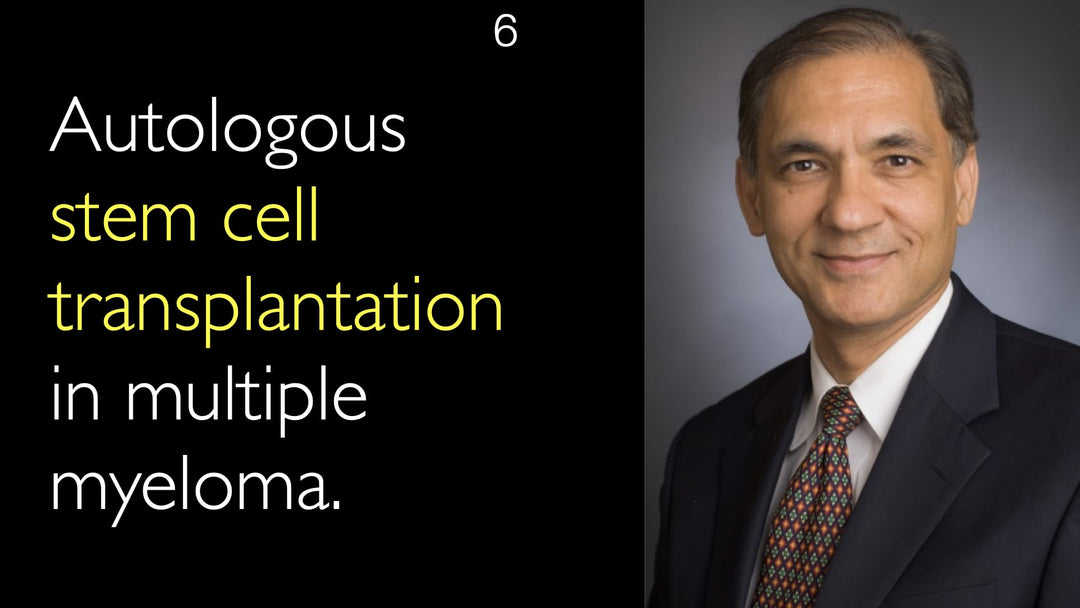Dr. Stephen Evans, MD, ein führender Experte für Pharmakovigilanz, erläutert, wie unerwünschte Arzneimittelwirkungen nach der Markteinführung von Medikamenten erkannt werden können. Er betont die Bedeutung der Überwachung großer elektronischer Gesundheitsdatenbanken und plädiert für vereinfachte Meldesysteme, um Ärzten die Erfassung vermuteter Nebenwirkungen zu erleichtern. Dr. Evans geht auch auf die Herausforderungen durch falsch-positive und falsch-negative Befunde bei der Erkennung unerwünschter Ereignisse ein. Eine kontinuierliche Überwachung neuer und bestehender Medikamente ist für die Patientensicherheit unerlässlich.
Effektive Pharmakovigilanz-Strategien zur Überwachung der Arzneimittelsicherheit nach der Zulassung
Direktnavigation
- Surveillance mittels elektronischer Patientenakten
- Meldung unerwünschter Ereignisse durch Ärzte
- Patientenmeldesysteme
- Big-Data-Analytik in der Pharmakovigilanz
- Herausforderungen bei der Erfassung unerwünschter Wirkungen
- Verbesserung der Arzneimittelsicherheitsüberwachung
- Vollständiges Transkript
Surveillance mittels elektronischer Patientenakten
Dr. Stephen Evans, MD, betont die entscheidende Rolle elektronischer Patientenaktendatenbanken in der Pharmakovigilanz. Er erläutert, dass die kontinuierliche Überwachung großer Gesundheitsdatenbanken essenziell für die Erkennung unerwünschter Arzneimittelwirkungen ist. Dieser Ansatz ermöglicht es Forschern, potenzielle Sicherheitsprobleme zu identifizieren, die in klinischen Studien nicht auffielen.
Dr. Evans hebt besonders die Bedeutung der Überwachung neuer Medikamente durch elektronische Patientenakten hervor. Er betont, dass eine umfassende Surveillance sowohl neu zugelassene als auch bereits etablierte Arzneimittel einschließen sollte. Dieser systematische Ansatz erlaubt eine frühere Erkennung seltener oder langfristiger Nebenwirkungen, die sonst unbemerkt bleiben könnten.
Meldung unerwünschter Ereignisse durch Ärzte
Dr. Stephen Evans, MD, erörtert die zentrale Bedeutung ärztlicher Meldungen in Pharmakovigilanzsystemen. Er weist darauf hin, dass medizinisches Fachpersonal besonders befähigt ist, potenzielle arzneimittelbedingte unerwünschte Wirkungen zu erkennen. Ihre klinische Erfahrung ermöglicht es ihnen, Muster zu identifizieren, die auf Sicherheitsbedenken hindeuten könnten.
Dr. Evans plädiert dafür, die Meldung unerwünschter Ereignisse für Ärzte so einfach wie möglich zu gestalten. Er betont, dass eine Verringerung des administrativen Aufwands eine umfassendere Meldepraxis fördert. Regulierungsbehörden weltweit, einschließlich der FDA in den USA, profitieren von diesem optimierten Verfahren.
Patientenmeldesysteme
Dr. Stephen Evans, MD, behandelt die Rolle patientengemeldeter unerwünschter Ereignisse in der Pharmakovigilanz. Er weist darauf hin, dass Patienten im Vereinigten Königreich und in Europa vermutete Arzneimittelnebenwirkungen direkt an Regulierungsbehörden melden können. Dieser patientenzentrierte Ansatz liefert zusätzliche Daten für die Arzneimittelsicherheitsüberwachung.
Allerdings beobachtet Dr. Evans, dass Patienten häufig geringfügige Nebenwirkungen melden, die für sie persönlich relevant sein mögen, aber klinisch weniger dringlich sind. Obwohl diese Meldungen zu den Gesamtsicherheitsprofilen beitragen, betont er, dass ärztliche Meldungen entscheidend bleiben, um schwerwiegende unerwünschte Reaktionen zu identifizieren, die sofortige regulatorische Maßnahmen erfordern.
Big-Data-Analytik in der Pharmakovigilanz
Dr. Stephen Evans, MD, untersucht die Anwendung von Big-Data-Ansätzen in der Pharmakovigilanz. Er beschreibt, wie fortschrittliche Computermethoden große elektronische Patientenaktendatensätze analysieren, um potenzielle unerwünschte Wirkungen zu erkennen. Diese analytischen Techniken können Muster identifizieren, die traditionellen Überwachungsmethoden entgehen.
Dr. Evans erläutert, dass spezialisierte Analysten mit umfangreichen Sicherheitsdaten arbeiten, um besorgniserregende Trends zu erkennen. Er betont, dass diese Big-Data-Ansätze die Spitzentechnologie der Arzneimittelsicherheitsüberwachung darstellen. Sie ermöglichen es, große Informationsmengen effizienter zu verarbeiten als manuelle Überprüfungsmethoden.
Herausforderungen bei der Erfassung unerwünschter Wirkungen
Dr. Stephen Evans, MD, anerkennt die erheblichen Herausforderungen bei der genauen Erfassung unerwünschter Wirkungen. Er vergleicht den Prozess mit diagnostischen Tests und weist darauf hin, dass sowohl falsch-positive als auch falsch-negative Ergebnisse in der Pharmakovigilanz auftreten. Falsch-positive Ergebnisse deuten auf nicht vorhandene Schäden hin, während falsch-negative tatsächliche Arzneimittelrisiken übersehen.
Dr. Evans erklärt, dass diese Erfassungsprobleme der Arzneimittelsicherheitsüberwachung inhärent sind. Trotz fortschrittlicher Systeme können einige unerwünschte Wirkungen zunächst unentdeckt bleiben. Er betont, dass kontinuierliche Verbesserungen der Überwachungstechniken helfen, beide Arten von Erfassungsfehlern langfristig zu minimieren.
Verbesserung der Arzneimittelsicherheitsüberwachung
Dr. Stephen Evans, MD, skizziert Strategien zur Verbesserung von Pharmakovigilanzsystemen weltweit. Er betont, dass eine bessere Surveillance in elektronischen Patientenaktendatenbanken eine primäre Verbesserungsmöglichkeit darstellt. Umfassende Datenerfassung und -analyse ermöglichen eine effektivere Erkennung arzneimittelbedingter Schäden.
Dr. Evans schließt, dass die Optimierung sowohl elektronischer Überwachungs- als auch ärztlicher Meldesysteme erreichbar ist. Er ist überzeugt, dass die Umsetzung dieser Verbesserungen die Arzneimittelsicherheit für Patienten erheblich steigern wird. In seiner Diskussion mit Dr. Anton Titov, MD, betont Dr. Evans, dass die fortlaufende Verfeinerung von Pharmakovigilanzmethoden für den Schutz der öffentlichen Gesundheit unerlässlich bleibt.
Vollständiges Transkript
Dr. Anton Titov, MD: Professor Evans, Sie sind ein Experte für Pharmakovigilanz – die kontinuierliche Überwachung unerwünschter Arzneimittelwirkungen nach der Zulassung, wenn Ärzte beginnen, das Medikament Patienten zu verschreiben. Was sind die besten Praktiken zur Erkennung unerwünschter Arzneimittelreaktionen bei Medikamenten, die bereits auf dem Markt sind? Und was sind die häufigen Probleme bei der Überwachung unerwünschter Arzneimittelwirkungen heute?
Dr. Stephen Evans, MD: Für mich gibt es zwei Dinge, die wir in großem Umfang tun können. Erstens: Unter der Annahme, dass alle finanzierbaren Studien durchgeführt wurden, müssen wir eine bessere Überwachung in großen elektronischen Patientenaktendatenbanken durchführen. Wir müssen sicherstellen, dass die Daten in diesen für die Forschung nutzbar sind und kontinuierlich überwacht werden.
Insbesondere bei neuen Medikamenten, aber auch bei allen Arzneimitteln, damit wir Schäden erkennen können, wo sie auftreten. In einigen Bereichen funktioniert das auf Basis von Aufzeichnungen nicht sehr gut.
Zweitens können wir es Ärzten erleichtern, vermutete unerwünschte Reaktionen zu melden. Menschen, ob Patienten oder medizinisches Fachpersonal, sind sehr gut darin, den Verdacht zu hegen, dass ein Medikament eine unerwünschte Wirkung verursacht hat. Manchmal, ja sogar häufig, ist dieser Verdacht unbegründet.
Dennoch ist es wertvoll, diesen Verdacht zu haben. Der Prozess der Meldung an die FDA in den USA oder an Regulierungsbehörden weltweit sollte für den Arzt oder die medizinische Fachkraft, die diesen bestimmten Effekt beobachtet, mit minimalem Aufwand verbunden sein.
Im Vereinigten Königreich und tatsächlich in Europa erlauben wir Patienten, solche Dinge selbst zu melden. Aber sie melden oft triviale Nebenwirkungen, die für sie wichtig sein können und für Regulierungsbehörden von Bedeutung sein mögen. Wir benötigen wirklich sehr gute Meldungen von Ärzten.
Dieses Verfahren so einfach wie möglich zu gestalten, ist meiner Meinung nach das Beste, was wir tun können. Ich habe beide Dinge getan. Wir haben Analysten, die die eingehenden Daten analysieren können, und wir können vielleicht sehr große Datenmengen – um das Modewort zu verwenden – im Zeitalter computerbasierter Big-Data-Ansätze für elektronische Patientenakten nutzen, um potenzielle unerwünschte Wirkungen erkennen zu können.
Das Problem ist natürlich, dass man ähnlich wie bei diagnostischen Tests falsch-positive und falsch-negative Ergebnisse haben wird. Man findet Schäden, wo es eigentlich keine gibt, und man übersieht Schäden, wo welche vorhanden sind. Aber all dies besser zu machen, ist möglich.