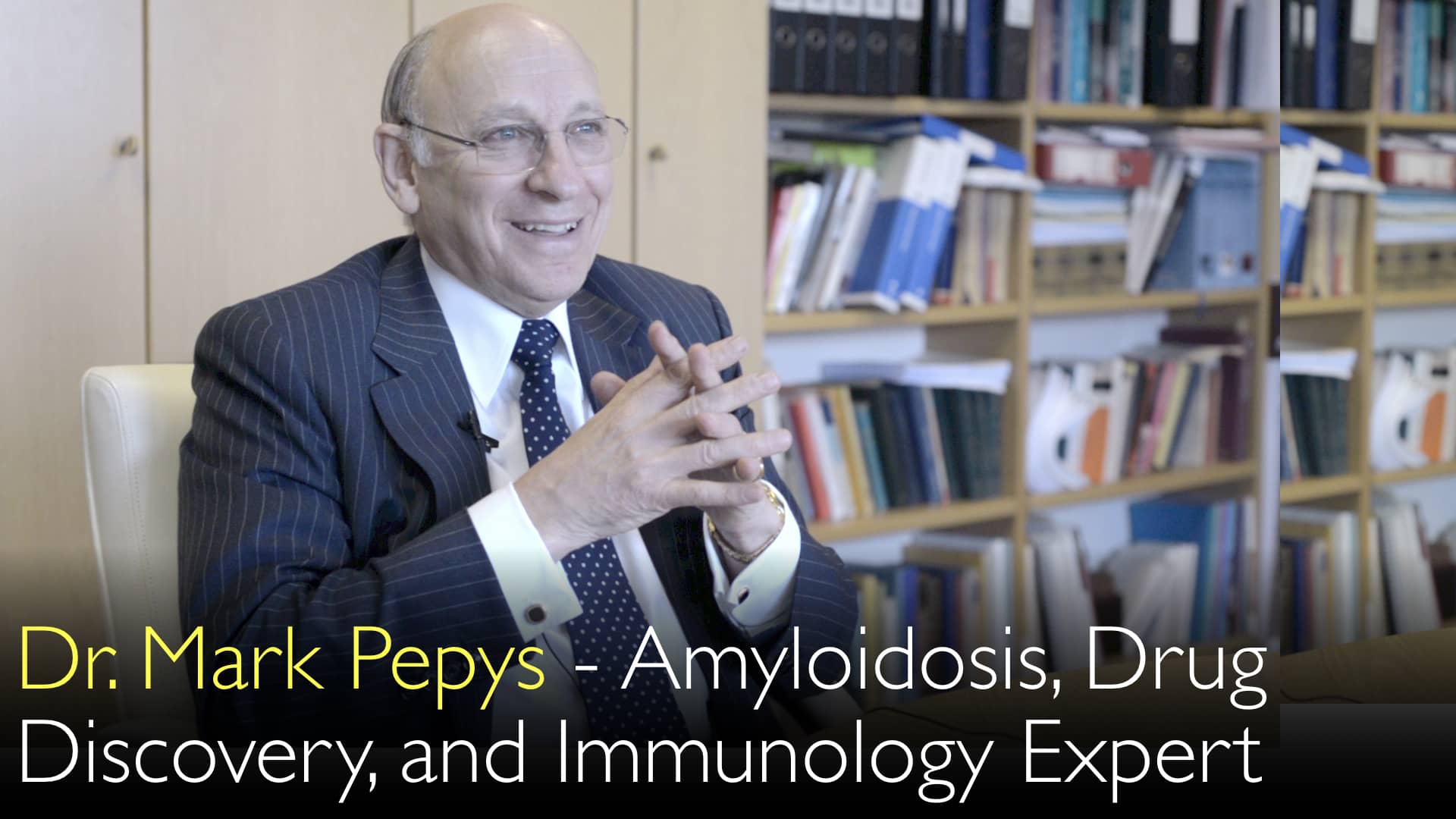Dr. Mark Pepys, MD, ein führender Experte auf dem Gebiet der Immunologie und CRP-Forschung, erläutert die tatsächliche Rolle von CRP bei Herzerkrankungen. Er betont, dass CRP kein ursächlicher Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse ist. Dr. Pepys geht detailliert darauf ein, wie frühe Studien durch unreines Protein in die Irre geführt und Korrelation mit Kausalität verwechselt haben. Sein Team hat entdeckt, dass CRP Schäden während eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls sogar verschlimmert. Dr. Mark Pepys, MD, erörtert zudem die Entwicklung einer therapeutischen Verbindung, die CRP blockiert und so Herzschäden reduziert.
C-reaktives Protein verstehen: Risikomarker vs. Ursache bei Herzerkrankungen
Direkt zum Abschnitt
- CRP als Risikomarker, nicht als Ursache
- Mängel in der frühen CRP-Forschung
- Genetische Evidenz gegen Kausalität
- Die tatsächliche biologische Rolle von CRP
- CRP verschlimmert Herzinfarktschäden
- Therapeutische Zielstruktur und Arzneimittelentwicklung
- Vollständiges Transkript
CRP als Risikomarker, nicht als Ursache
Dr. Mark Pepys, MD, betont einen entscheidenden Unterschied zwischen Risikomarker und Risikofaktor bei kardiovaskulären Erkrankungen. Ein Risikofaktor wie Cholesterin trägt direkt zum Krankheitsgeschehen bei – seine Senkung schützt vor Atherosklerose. C-reaktives Protein hingegen ist lediglich ein mäßig signifikanter Risikomarker. Dr. Pepys weist darauf hin, dass es sich hier nicht um Wortklauberei, sondern um eine ernsthafte wissenschaftliche Frage handelt. Die Gleichsetzung von Korrelation mit Kausalität hat zu weitverbreiteten Missverständnissen über die Rolle von CRP bei der Herzgesundheit geführt.
Mängel in der frühen CRP-Forschung
Dr. Mark Pepys, MD, erläutert, wie frühe epidemiologische Studien zu irreführenden Ergebnissen kamen. Zwar umfassten diese Tausende Teilnehmer, doch die Anzahl tatsächlicher Herzinfarkte war sehr gering. Dadurch ergaben sich statistische Auffälligkeiten, die eine extrem hohe Korrelation zwischen Ausgangs-CRP und späteren Herzinfarkten suggerierten. Als Metaanalysen mit Hunderttausenden Teilnehmern durchgeführt wurden, erwies sich der Zusammenhang als deutlich schwächer. Ähnlich schwache Korrelationen finden sich auch bei anderen Entzündungsmarkern wie niedrigem Albumin oder der Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) – nichts also, was spezifisch für CRP wäre.
Zusätzliche Verwirrung entstand durch fehlerhafte In-vitro-Experimente. Kommerziell bezogenes CRP war oft unrein und mit bakteriellen Lipopolysacchariden kontaminiert, die stark entzündungsfördernd wirken. Wurde dieses verunreinigte CRP auf Zellen gegeben, löste es heftige Entzündungsreaktionen aus – fälschlicherweise dem CRP selbst zugeschrieben. Dr. Anton Titov, MD, bespricht diese Ergebnisse mit Dr. Pepys, der die Bedeutung reinster Reagenzien in der medizinischen Forschung unterstreicht.
Genetische Evidenz gegen Kausalität
Der eindeutigste Beleg gegen eine kausale Rolle von CRP bei Herzerkrankungen stammt aus der genetischen Epidemiologie, insbesondere der Mendelschen Randomisierung. Dr. Mark Pepys, MD, erklärt, wie bestimmte Gene das Basis-CRP-Niveau eines Menschen steuern: Manche haben von Natur aus Werte um 0,1 mg/l, andere um 5 mg/l. Wäre CRP kausal, müssten Menschen mit Genen für höhere CRP-Spiegel deutlich häufiger an kardiovaskulären Erkrankungen leiden. Große genetische Studien zeigen jedoch keinerlei Zusammenhang zwischen diesen CRP-regulierenden Genen und dem Risiko für Herzinfarkte oder Schlaganfälle – ein klarer Beweis, dass CRP keine kardiovaskulären Ereignisse verursacht.
Die tatsächliche biologische Rolle von CRP
Dr. Mark Pepys, MD, klärt die eigentliche Funktion von C-reaktivem Protein auf: CRP ist ein Bindungsprotein, eng verwandt mit der Serumamyloid-P-Komponente (SAP). Es erkennt und bindet an Phosphocholinreste, die auf Membranen abgestorbener oder geschädigter Zellen freigelegt werden. Diese Bindung aktiviert das Komplementsystem – einen Teil des Immunsystems, der für die Beseitigung von Zelltrümmern und Pathogenen zuständig ist. In dieser Rolle unterstützt CRP als Fresszellenaktivator die Reinigung des Gewebes nach Verletzungen oder Zelltod und ist Teil der natürlichen Abwehr- und Reparaturmechanismen des Körpers.
CRP verschlimmert Herzinfarktschäden
Trotz seiner hilfreichen Rolle bei der Beseitigung von Zelltrümmern machten Dr. Mark Pepys, MD, und sein Team 1999 eine entscheidende Entdeckung: Bei akuten Ereignissen wie einem Herzinfarkt wirkt CRP schädlich. Wird eine Koronararterie blockiert, sterben Herzmuskelzellen aufgrund von Sauerstoffmangel ab. CRP bindet an diese absterbenden Zellen und aktiviert das Komplementsystem – was die Entzündungsreaktion erheblich verstärkt, die Infarktgröße vergrößert und den Schaden verschlimmert. Das Team validierte diesen Mechanismus in Tiermodellen: Die Infusion von humanem CRP bei Ratten mit induziertem Herzinfarkt steigerte den Schaden in komplementabhängiger Weise deutlich.
Therapeutische Zielstruktur und Arzneimittelentwicklung
Diese Erkenntnis machte CRP zu einem vielversprechenden therapeutischen Ziel für akute Zustände. Dr. Mark Pepys, MD, erklärt, dass sein Team daraufhin ein Medikament entwickelte, das die Bindung von CRP an geschädigte Zellen blockiert. Ziel war es, den komplementvermittelten Schaden bei Herzinfarkt oder Schlaganfall zu reduzieren. Es gelang, eine Reihe wirksamer Wirkstoffkandidaten zu entwickeln, die in Tiermodellen hervorragend funktionierten. Diese wurden für intravenöse Infusionen konzipiert, ideal also für hospitalisierte Patienten mit akuten Ereignissen.
Doch der Weg der Arzneimittelentwicklung ist bekanntlich steinig. Dr. Anton Titov, MD, und Dr. Pepys erörtern die enormen Herausforderungen: Die ursprünglichen Verbindungen ließen sich nur schwer in dem für die pharmazeutische Produktion nötigen großen Maßstab reinigen, was ihre Entwicklung stoppte. Dr. Pepys betont, dass sein Team nun intensiv an neuen, besser handhabbaren Molekülen arbeitet, die denselben Effekt haben – CRP blockieren und Gewebeschäden begrenzen –, sich aber als stabile, kostengünstige Medikamente herstellen lassen.
Vollständiges Transkript
Dr. Anton Titov, MD: Ist CRP [C-reaktives Protein] ein "Risikofaktor" für Herzerkrankungen?
Dr. Mark Pepys, MD: C-reaktives Protein ist tatsächlich ein mäßig signifikanter Risikomarker für kardiovaskuläre Erkrankungen. Aber diese Geschichte wurde stark überbewertet. Man begann, CRP als "Risikofaktor" zu bezeichnen. Ein Risikofaktor ist etwas, das tatsächlich zur Erkrankung beiträgt. Cholesterin ist ein Risikofaktor. Wir wissen, dass Cholesterin Atherosklerose verursacht. Ist der Cholesterinspiegel zu hoch, entwickelt man Atherosklerose. Senkt man ihn, schützt man sich davor.
Wieder einmal wird mit den Begriffen leichtfertig umgegangen! Das ist nicht nur Semantik, sondern ein ernsthafter wissenschaftlicher Fehler: die Gleichsetzung von Korrelation mit Kausalität. Man führte epidemiologische Studien durch, die groß wirkten, weil Tausende von Personen einbezogen waren. Aber die Anzahl der Ereignisse – der Herzinfarkte – war sehr gering.
Es spielt keine Rolle, ob man 10.000 Personen in einer Studie hat. Wenn es nur hundert Herzinfarkte gibt, kann man diese nach dem CRP-Wert von vor einem Jahr oder zehn Jahren in Quintile einteilen. Da lassen sich alle möglichen merkwürdigen Ergebnisse erzielen.
Die ursprünglichen epidemiologischen Daten deuteten auf eine fantastisch hohe Korrelation zwischen erhöhtem Ausgangs-CRP und dem späteren Herzinfarktrisiko hin. Doch als die Epidemiologie angemessene Maßstäbe erreichte – Hunderttausende von Menschen, Metaanalysen oder sehr große Studien –, erwies sich der Zusammenhang als viel, viel schwächer. Er ist zwar noch da, aber bescheiden.
Das bedeutet im Grunde nicht viel. Die gleiche Korrelation findet man bei vielen anderen Entzündungsmarkern. Es ist nichts Spezifisches für CRP. Es gibt eine schwache Korrelation mit niedrigem Albumin; steigt das CRP, sinkt Albumin. Oder mit der Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG), oder mit Zytokinen – all so etwas.
Das war also eine vollständige Fehlinterpretation von Korrelation als Kausalität. Verschärft wurde sie durch In-vitro-Experimente mit kommerziell bezogenem CRP. C-reaktives Protein war unrein, mit bakteriellen Lipopolysacchariden kontaminiert, die stark entzündungsfördernd wirken. Gab man das auf Zellen, reagierten diese heftig. Forscher sagten: "Dieses CRP verursacht Atherosklerose!"
Man führte sogar In-vivo-Experimente durch, infundierte dieses verunreinigte Material in Menschen. Es kam zu starker Entzündung. Der Körper reagiert heftig auf bakterielle Polysaccharide. Ja, CRP wurde als entzündungsfördernd dargestellt. Dabei stellte sich heraus, dass es das nicht ist.
Wir waren sehr besorgt über diese Berichte und konnten sie in vitro oder in Tiermodellen nicht reproduzieren. Wir stellten pharmazeutisches humanes CRP aus Spenderblut her – ein mühsamer, teurer Prozess. Wir infundierten es in gesunde Freiwillige. Und raten Sie, was passierte? Absolut nichts!
Wir zeigten, dass CRP bei Gesunden nicht entzündungsfördernd ist. Die ganze Geschichte von CRP als Risikomarker für Atherosklerose und kardiovaskuläres Risiko ist falsch. Das ist vom Tisch.
Der letzte Nagel zum Sarg war die sogenannte "genetische Epidemiologie" oder Mendelsche Randomisierung. Es gibt Gene, die unterschiedliche Basis-CRP-Spiegel oder Akute-Phase-Reaktionen steuern. Es gibt Polymorphismen in der Bevölkerung: Manche Menschen haben ein Basis-CRP von 0,1 mg pro Liter, andere von 5 mg pro Liter. Manchmal steigt bei einer Akute-Phase-Reaktion das eine mehr als das andere.
Nun stellen Sie sich vor, CRP würde kardiovaskuläre Erkrankungen verursachen. Dann hätten Menschen mit Genen für mehr CRP mehr kardiovaskuläre Erkrankungen, Menschen mit niedrigeren Spiegeln weniger. Es stellt sich heraus: Es gibt keine Beziehung. Gene, die die CRP-Produktion kontrollieren, und ob man Herzinfarkte oder Schlaganfälle bekommt – keine Beziehung. Gar keine.
Egal, was man in In-vitro-Experimenten fand, egal, was man über Infusionen diskutiert – es ist klar, dass CRP keine Herzinfarkte und Schlaganfälle verursacht.
Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass CRP ein Bindungsprotein ist, sehr eng mit SAP verwandt, über das wir im Zusammenhang mit Amyloidose sprachen. SAP bindet an Amyloidfibrillen. Woran bindet CRP? CRP bindet an tote oder geschädigte Zellen. Es erkennt Phosphocholinreste.
Diese chemischen Reste sind allgegenwärtig in Plasmamembranen, in Phospholipiden. Sie werden freigelegt, wenn Zellen krank, sterbend oder tot sind. CRP bindet daran und aktiviert das Komplementsystem im Blut – ein entzündungsförderndes Abwehrsystem, das der Körper nutzt, um Bakterien und Zelltrümmer loszuwerden.
Wir nutzen es in der Amyloidbehandlung, um Ablagerungen zu beseitigen: Der Antikörper aktiviert Komplement, das die Amyloidablagerungen entfernt. Der Körper verwendet CRP, um an tote Zellen zu binden und Komplement zu aktivieren, und hilft so, tote Zellen zu beseitigen.
Doch wir zeigten 1999 – viele hatten es "angedeutet", "beobachtet", "vorgeschlagen" – erstmals definitiv: CRP verschlimmert den Schaden bei einem Herzinfarkt.
Bei einem Herzinfarkt ist eine Koronararterie blockiert, arterielles Blut erreicht einen Teil des Herzmuskels nicht, Zellen sterben ab. Bringt man humanes CRP in Rattenexperimente ein, aktiviert es das Komplementsystem der Ratte und vergrößert die Infarktgröße erheblich – komplementabhängig. Wir kennen den Mechanismus; wir haben alle beteiligten Moleküle nachgewiesen.
Dr. Anton Titov, MD: Das bestätigt CRP als therapeutisches Ziel.
Dr. Mark Pepys, MD: Denn bei jedem, der an einem Herzinfarkt verstorben ist, findet man CRP und Komplement in und um den Infarkt. Der abgestorbene Muskel ist da, C-reaktives Protein ist immer vorhanden. Diese Moleküle verschlimmern die Situation. Unser Ziel war, ein Medikament zu entwickeln, das die CRP-Bindung hemmt.
Wir zeigten dasselbe in einem Rattenmodell für Schlaganfall: Humanes CRP vergrößert den Schaden. Also machten wir uns daran, Moleküle zu entwickeln, die die CRP-Bindung blockieren. Solche Medikamente könnten den Schaden bei einem Herzinfarkt verringern. Wir entwickelten erfolgreiche Wirkstoffkandidaten und eine Familie von Verbindungen.
Dr. Anton Titov, MD: Das hat im Tiermodell sehr, sehr gut funktioniert.
Dr. Mark Pepys, MD: Aber sie erwiesen sich als nicht entwicklungsfähig für den Medikamenteneinsatz, zumindest bisher. Wir sprachen schon über den Albtraum der Arzneimittelentwicklung – es ist wirklich einer. Nichts, was die Menschheit tut, ist so schwierig, langsam und teuer wie der Versuch, ein neues Medikament zu entwickeln. Es kann Jahrzehnte dauern und Milliarden kosten. Ein unbeschreiblicher Albtraum.
Diese speziellen Moleküle schienen vielversprechend, zumindest für Infusionen. Sie sind nicht oral einzunehmen, aber intravenös applizierbar – in Ordnung für hospitalisierte Patienten mit Herzinfarkt, Schlaganfall, Verbrennungen (wo CRP ebenfalls Schäden verursacht) oder Trauma. Aber sie ließen sich nur schwer in dem für die Arzneimittelentwicklung nötigen Maßstab reinigen.
Dr. Anton Titov, MD: Die Entwicklung dieser Moleküle wurde eingestellt.
Dr. Mark Pepys, MD: Wir versuchen derzeit, mit erheblichen Schwierigkeiten, andere Moleküle zu entwickeln, die dasselbe leisten. Sie sollen gut handhabbare Feststoffe sein, die in großen Mengen zu akzeptablen Kosten hergestellt werden können. Wir stecken tief in dieser Entwicklung. Vielleicht möchte ja jemand kommen und uns ein paar Millionen Pfund geben, um diese Reise zu unterstützen – das würden wir mit großer Dankbarkeit annehmen!