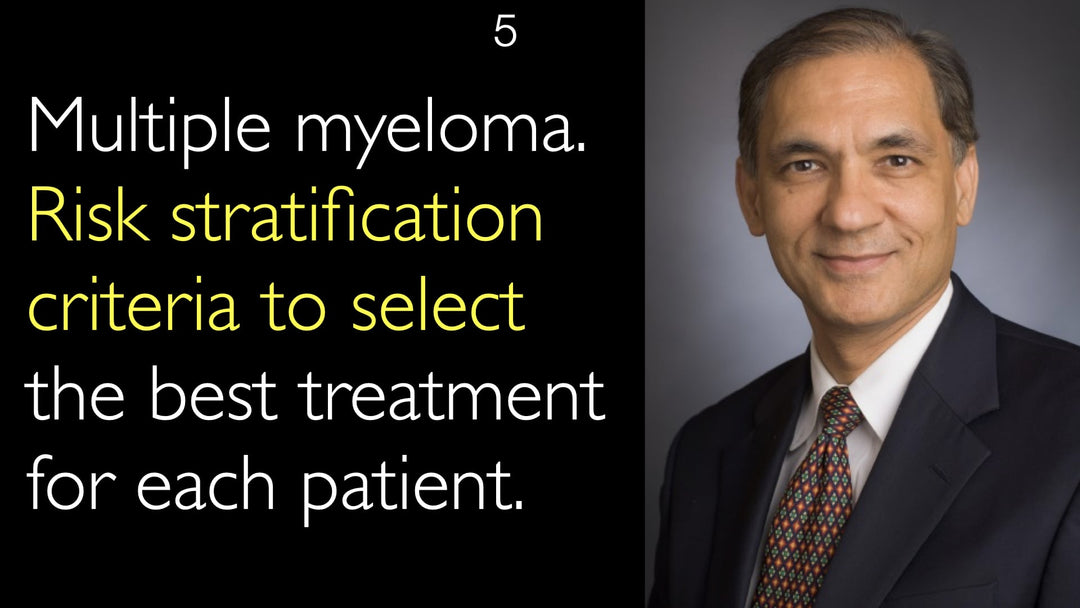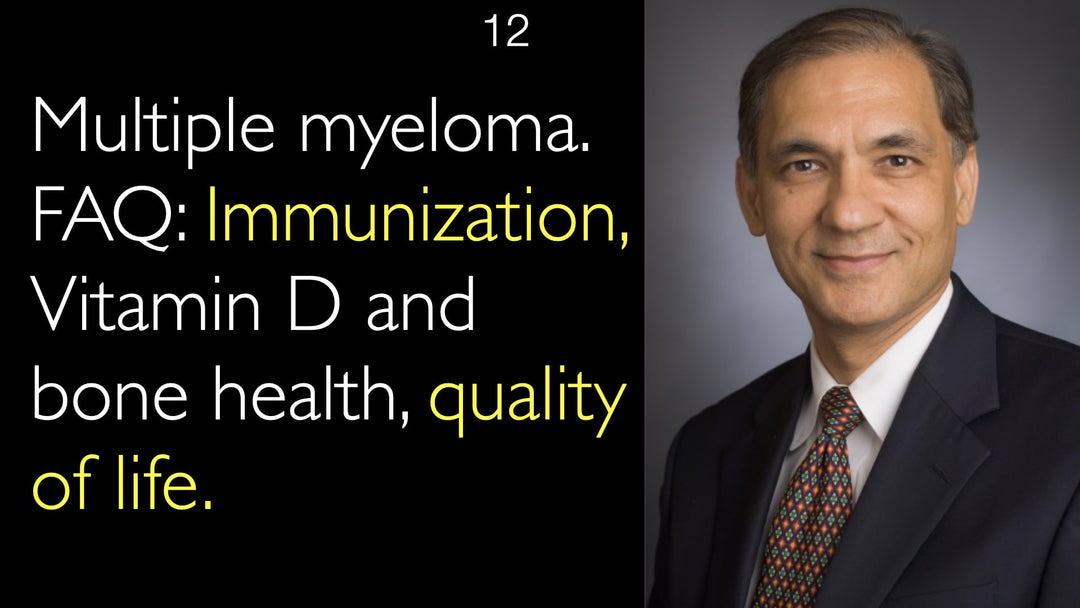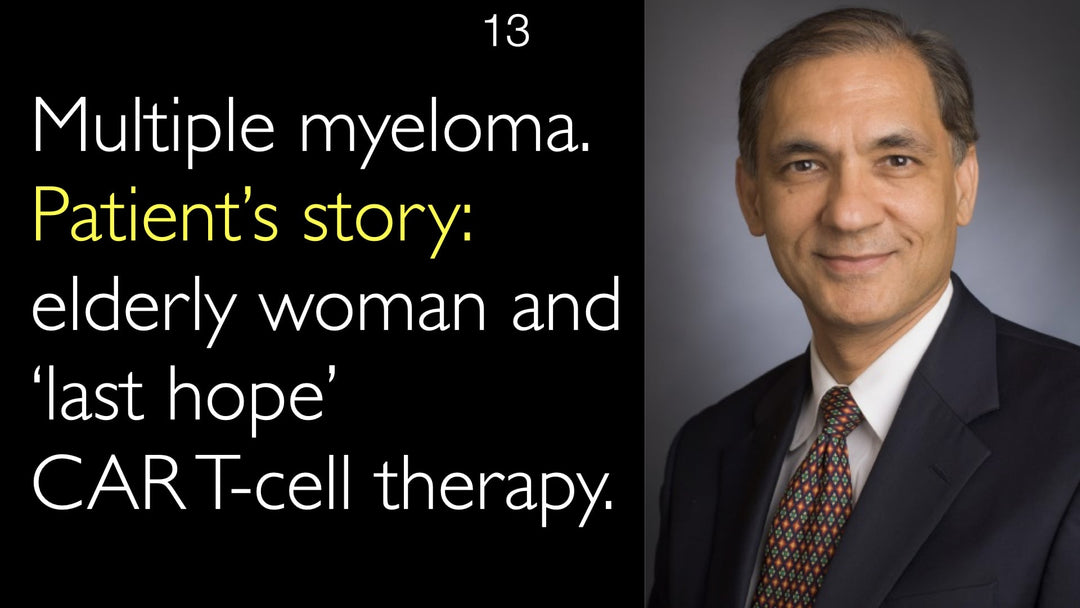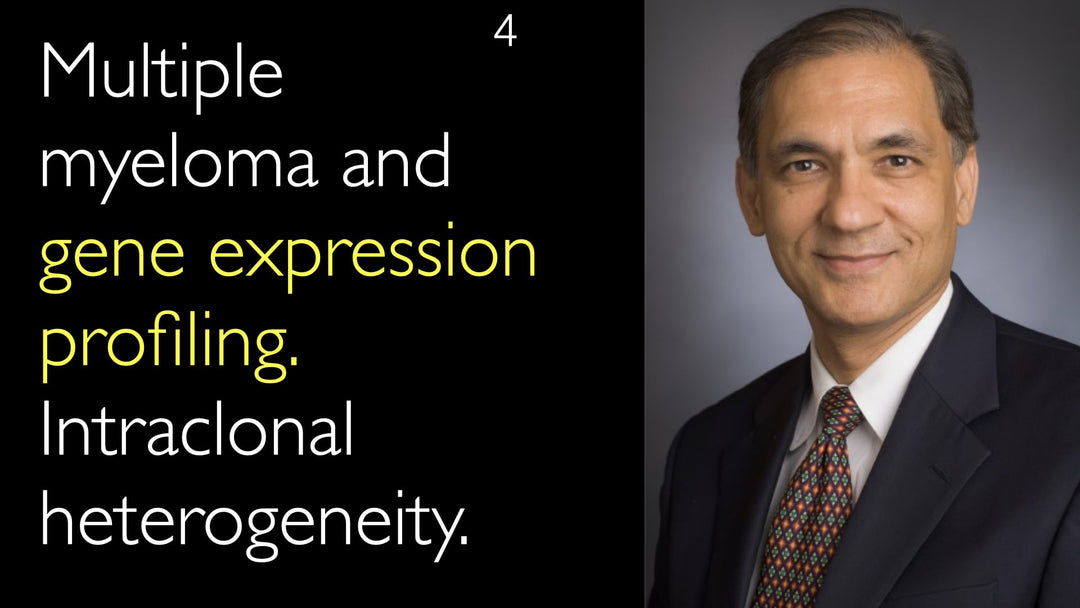Dr. Nikhil Munshi, MD, ein führender Experte für multiples Myelom, erläutert, wie die Risikostratifizierung die Therapieentscheidungen lenkt. Er geht detailliert auf die Entwicklung der Kriterien ein – vom Durie-Salmon-System bis hin zur modernen zytogenetischen und molekularen Profilerstellung. Dr. Munshi behandelt zentrale Hochrisikomerkmale wie spezifische chromosomale Translokationen und 1q-Amplifikationen. Das Revidierte Internationale Staging-System (R-ISS) kombiniert Zytogenetik mit einfachen Bluttests, um eine weltweite Anwendbarkeit zu gewährleisten. Neue Technologien wie die Vollgenomsequenzierung stehen im Aufbruch, um die Risikobewertung noch präziser zu gestalten. Diese Stratifizierung ermöglicht eine maßgeschneiderte, intensivere Therapie für Hochrisikopatienten.
Risikostratifizierung und Therapieauswahl beim Multiplen Myelom
Direktnavigation
- Entwicklung der Risikostratifizierung
- Aktuelle zytogenetische Risikokriterien
- ISS-Staging-System
- Revidierte ISS-Stadieneinteilung
- Neue genomische Technologien
- Therapeutische Implikationen des Risikos
- Vollständiges Transkript
Entwicklung der Risikostratifizierung
Die Risikostratifizierung beim Multiplen Myelom hat sich im Laufe der Zeit erheblich weiterentwickelt. Laut Dr. Nikhil Munshi, MD, kam früher das Durie-Salmon-System zum Einsatz. Neue Chemotherapeutika und Transplantationsverfahren veränderten jedoch die Schwerpunkte der Risikobewertung. In dieser Phase erwies sich die Deletion von Chromosom 13 als entscheidender Marker. Moderne Therapieerfolge haben inzwischen neue genomische Merkmale identifiziert, die das Patientenrisiko präziser erfassen.
Aktuelle zytogenetische Risikokriterien
Die gegenwärtige Risikostratifizierung beim Multiplen Myelom konzentriert sich auf spezifische Chromosomenanomalien. Dr. Nikhil Munshi, MD, nennt Translokationen von Chromosom 14 mit Chromosom 4, 16 oder 20 als Hochrisikomerkmale. Die Amplifikation von Chromosom 1q hat sich als weiterer bedeutender Hochrisikomarker etabliert. Die Erforschung anderer potenzieller Risikofaktoren wie der 1p-Deletion wird fortgesetzt. Diese zytogenetischen Auffälligkeiten helfen Onkologen, Patienten mit aggressiverer Krankheitsbiologie zu erkennen.
ISS-Staging-System
Das International Staging System (ISS) bietet ein weltweit zugängliches Instrument zur Risikobewertung. Dr. Nikhil Munshi, MD, betont, dass für das ISS-Staging lediglich zwei einfache Blutuntersuchungen nötig sind. Serumalbumin und Serum-Beta-2-Mikroglobulin bestimmen das Stadium. ISS-Stadium 1 und 2 deuten auf ein Multiples Myelom mit besserer Prognose hin. ISS-Stadium 3 kennzeichnet Patienten mit aggressiverer Erkrankung, die intensive Behandlungsstrategien erfordern.
Revidierte ISS-Stadieneinteilung
Das Revidierte International Staging System (R-ISS) kombiniert zytogenetische und Laborbefunde. Dr. Nikhil Munshi, MD, erläutert, wie das R-ISS das ISS-Staging mit zytogenetischen Risikofaktoren verbindet. Dieser umfassende Ansatz schafft ein präziseres prognostisches Modell. R-ISS-Stadium-3-Patienten haben trotz moderner Therapien deutlich schlechtere Outcomes. Dieses Staging-System gilt derzeit als weltweiter Standard für die Risikostratifizierung beim Multiplen Myelom.
Neue genomische Technologien
Fortschrittliche genomische Technologien revolutionieren die Risikobewertung beim Multiplen Myelom. Dr. Nikhil Munshi, MD, hebt hervor, dass die Vollgenomsequenzierung schneller und erschwinglicher geworden ist. Was einst Wochen und Tausende von Dollar kostete, ist heute in Tagen und zu geringeren Kosten möglich. Forscher untersuchen Mutationslast und klonale Heterogenität als prognostische Indikatoren. Eine heterogenere Erkrankung scheint mit einer ungünstigeren Prognose beim Multiplen Myelom einherzugehen.
Therapeutische Implikationen der Risikostratifizierung
Die Risikostratifizierung beeinflusst unmittelbar die Behandlungsentscheidungen beim Multiplen Myelom. Dr. Nikhil Munshi, MD, erklärt, dass Hochrisikopatienten aggressivere Therapieansätze erhalten. Behandlungsintensität und -dauer werden anhand individueller Risikoprofile angepasst. Neue Medikamente wie Bortezomib haben die Ergebnisse bestimmter Hochrisikogruppen verbessert. Standardrisikopatienten können weniger intensive Schemata erhalten, um die Behandlungstoxizität zu minimieren und gleichzeitig die Wirksamkeit zu gewährleisten.
Vollständiges Transkript
Dr. Nikhil Munshi, MD: Die Präzisionsmedizin lehrt uns, dass jeder Krebspatient einzigartig ist, und das Multiple Myelom ist eine heterogene Erkrankung. Eine korrekte Risikostratifizierung jedes Patienten mit Multiplem Myelom ist entscheidend für die Auswahl der optimalen Therapie und für die bestmögliche Prognose.
Dr. Anton Titov, MD: Was sind die wichtigsten Risikostratifizierungskriterien und Herausforderungen beim Multiplen Myelom?
Dr. Nikhil Munshi, MD: Das ist eine komplexe, aber zentrale Frage. Risikostratifizierungskriterien gibt es schon lange; früher nutzten wir das Durie-Salmon-System. Mit der Entwicklung neuer Behandlungen – damals neue Chemotherapeutika – begannen wir, Transplantationen einzusetzen. Da verlor das Durie-Salmon-System an Bedeutung, und Merkmale wie die Chromosom-13-Deletion rückten in den Vordergrund.
Dank neuer Medikamente identifizieren wir inzwischen weitere Merkmale für die Risikostratifizierung. Derzeit gelten beispielsweise Translokationen von Chromosom 14 mit Chromosom 4, 16 oder 20 als relevant. Seit kurzem ist auch die Amplifikation von Chromosom 1q wichtig.
Weitere Merkmale wie die 1p-Deletion werden erforscht und sind Gegenstand laufender Untersuchungen. Bei der Risikostratifizierung beobachten wir, dass neue Medikamente, die bei Hochrisikoerkrankungen wirken, bestimmte Merkmale entwerteten, während andere neu hinzukommen.
So war das t(4;14)-Myelom einst hochriskant. Mit Medikamenten wie Bortezomib können wir das durch diese Translokation bedingte Risiko teilweise ausgleichen. Es bleibt eine Hochrisikogruppe, aber die Patienten haben bessere Outcomes als früher.
Dafür gewinnt 1q an Bedeutung. Diese Stratifizierung erfolgt durch Chromosomenanalyse – eine Methode. Eine zweite ist das ISS-Staging-System, das weltweit mit minimalem technischen Aufwand durch Messung von Serumalbumin und Serum-Beta-2-Mikroglobulin im Blut angewendet werden kann.
Zwei einfache Labortests zeigen, ob ein Patient im ISS-Stadium 1 oder 2 liegt, was günstigere Stadien sind, oder im Stadium 3, das aggressiver verläuft. Dann kombinierten wir ISS-Stadium und zytogenetische Befunde zum revidierten ISS. Patienten im Stadium 3 schneiden schlechter ab.
Das ist heute Standard; es wird allgemein genutzt. Wir treffen uns regelmäßig, um Neuerungen zu berücksichtigen. Mit moderner Technologie können wir Vollgenomsequenzierungen durchführen.
Zum Vergleich: Vor 10–15 Jahren dauerte die Sequenzierung Wochen bis Monate und kostete Tausende Dollar. Heute liefert die Vollgenomsequenzierung Ergebnisse in weniger als einer Woche, manchmal in drei Tagen; sie ist sofort verfügbar und deutlich günstiger.
Diese Fortschritte fließen allmählich in die Praxis ein. Noch handelt es sich um Forschung, aber wir setzen sie bereits ein, um die Mutationslast zu bewerten. Sehr wichtig ist die klonale Heterogenität – wir gehen davon aus, dass eine heterogenere Erkrankung mit einer schlechteren Prognose einhergeht.
Wir beginnen, solche genomischen Parameter für eine neue Stratifizierung heranzuziehen. Bei Hochrisikopatienten können wir riskantere Behandlungen wählen, also aggressivere Therapien und möglicherweise längere Behandlungsdauern. Bei Standard- oder Niedrigrisikopatienten hingegen können Standardregime angewendet werden.